Archäologischer Landschaftspark

Im Eifelstädchen Nettersheim – nur eine knappe Autostunde von Köln entfernt – zeigt sich römische Geschichte hautnah: Hier an der wichtigen Agrippasstraße, die von Trier in das römische Colonia (Köln) führte, lag einst der römische Ort MARCOMAGUS.
Seit 2009 konnte das Archäologische Institut der Universität zu Köln Reste dieser Siedlung auffinden. Manche wurden für die Öffentlichkeit sichtbar gemacht. Darunter befinden sich Wohn- sowie Befestigungsanlagen, Reste der ursprünglichen Straßenführung, aber auch die bereits über die Eifel hinaus bekannte »Görresburg«, ein Matronenheiligttum.
Die Fundstellen wurden nun im Archäologischen Landschaftspark sichtbar und zugänglich gemacht (Eintritt frei). Ein eingerichteter Erlebnis-Rundweg (ca. vier Kilometer) mit 8 Erlebnisstationen lädt Interessierte und Wanderer dazu ein, den römischen Alltag kennen zu lernen. Startpunkt ist das Naturzentrum Eifel in Nettersheim. Hier erhalten Sie auch einen Flyer zum Landschaftspark, auf dem alle Stationen eingezeichnet und beschrieben sind. Der Park ist im Gelände ausgeschildert.
Familien und Gruppen finden darüber hinaus eine Vielzahl speziell zugeschnittener Veranstaltungen und Aktionen, um selbst hautnah in das römische Leben eintauchen zu können.
Diana-Denkmal
Dicht oberhalb des Bollendorfer Ortsteils Weilerbach steht am Wegesrand der übriggebliebene, aus massivem Sandstein herausgearbeitete Sockel eines römischen Diana-Weihebildes. Die römische Göttin der Jagd muss einst in eindrucksvoller Größe hier am unteren Hang des Ferschweiler Plateaus auf die Soldaten, Händler und sonstigen des Weges ziehenden Passanten herabgeblickt haben.
Die Sockelinschrift DEAE•DIANAE Q•POSTVMIVS•POTENS•V•S
bedeutet: Der Göttin Diana hat Quintus Postumius Potens (den Stein gewidmet und) das Gelübde erfüllt.
Warum der obere Teil des Denkmals zerstört wurde können wir nur vermuten. Die üblichen Verdächtigen sind die frühen Christen, denen die heidnischen Denkmäler ein Gräuel waren.
Bei der Ortschaft Duppach, die zum Landkreis Vulkaneifel zählt, wurden 2001 Reste von römischen Grabdenkmälern einer Villenanlage bei archäologischen Ausgrabungen entdeckt. Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts war über Skulpturenfunde, zum Beispiel eines lebensgroßen Jünglingskopfes und ein eingemauertes Relief im Nachbarort Steffeln, berichtet worden. Letzteres wurde Ende der 1990er Jahre gefunden und in Trier ins Rheinische Landesmuseum übergeben. Während weiterer Ausgrabungen ab dem Jahr 2002 in Kooperation der Universität zu Köln und des Rheinischen Landesmuseums Trier, entdeckte man zwei monumentale vollplastische Greifskulpturen. Auch in den Folgejahren fanden Ausgrabungen statt, um nachzuforschen, wie der Besitzer dieser Villa an solch einen Reichtum gelang.
Heute geht man davon aus, dass der Villenbesitzer als Ehrenstadtrat in Trier tätig war, als solcher finanzierte er unter anderem öffentliche Bauten.
Die gefundenen Grabsteinpfeiler waren aufwendig hergerichtet. Bunter Skulpturenschmuck zeigte Szenen der griechisch-römischen Sagenwelt.
2010 wurden zudem auch extravagante Krüge gefunden, die auf die Produktion von Bier hinweisen.
Nach den Germaneneinfällen wurde die Villenanlage neu besiedelt und die Steinanlagen durch Holzgebäude ersetzt. Die neuen Bewohner nutzten Eisenerz aus der Umgebung und verarbeiteten dieses in Schmieden weiter.
Im vierten Jahrhundert wurden die Grabdenkmäler vollständig abgebaut, um aus den alten Materialien neue Bauten zu errichten. Ab dem fünften Jahrhundert wurde dann die Villenanlage endgültig verlassen.
Der Duppacher Weiher südöstlich der Grabdenkmäler ist heutzutage trockengelegt und nur noch durch die ringförmige Struktur des Tales als Maar zu erkennen.
Das Fraubillenkreuz ist ein Menhir, der zu einem Kreuz umgearbeitet wurde. Er steht an einem Wegrand auf dem Ferschweiler Plateau in der Eifel, zwischen Ferschweiler, Schankweiler, Nusbaum-Rohrbach und Bollendorf.
Nach der Überlieferung hat der im Eifeler Raum verehrte Missionar Willibrord den etwa 5000 Jahre alten Menhir eigenhändig in Kreuzform umgemeißelt und so christianisiert. In den Stein sind zwei Figurennischen eingehauen, die von Löchern umgeben sind. Er ist heute noch etwa 3,5 Meter hoch.
Die Herkunft des Namens ist unklar. Es könnte sich um eine Ableitung aus »Unserer lieben Frau Bild-Kreuz« handeln. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass der Name aus der Bezeichnung Sybille entstanden ist, der für weissagende Frauen verwendet wurde. Für die letzte Möglichkeit spricht, dass der Menhir 1617 als »Sybillen Creutz« erwähnt wird.
Texte: wikipedia
Fraubillenkreuz in Google Maps
Hochmittelalterliche Glashütte
Auf der Kordeler Hochmark befindet sich ein hochmittelalterlicher Glasschmelzofen.
















 Achterhöhe, 380 m, Lutzerath
Achterhöhe, 380 m, Lutzerath

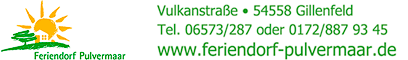





 »Begreifen durch erleben« mit viel Spaß, das ist das Konzept unserer außerschulischen Umweltpädagogik und unser Beitrag zur Nachhaltigkeit. Machen Sie Ihren nächsten Familienausflug oder Ihre Klassenfahrt in unsere schöne Eifelgemeinde mit ihrer erdgeschichtlichen, historischen und ökologischen Vielfalt.
»Begreifen durch erleben« mit viel Spaß, das ist das Konzept unserer außerschulischen Umweltpädagogik und unser Beitrag zur Nachhaltigkeit. Machen Sie Ihren nächsten Familienausflug oder Ihre Klassenfahrt in unsere schöne Eifelgemeinde mit ihrer erdgeschichtlichen, historischen und ökologischen Vielfalt.
 Hardtkopf, 596 m, Südeifel
Hardtkopf, 596 m, Südeifel