Das Römergrab »Strotzbüscher Tumm« ist ein Grabhügel mit tonnengewölbter Grabkammer aus mächtigen Rotsandsteinquadern und hat einen Durchmesser von 24 m und eine Höhe von 5 m. Sie befindet sich zwischen Strotzbüsch und Oberscheidweiler.
Diese Familiengrabstätte eines gallo-römischen Großgrundbesitzers stammt aus dem 3. Jahrhundert nach Christus.
Im Jahre 1821 wurde diese Grabstätte entdeckt und das erste Mal untersucht. Es wurden aber keine Bestattungsreste mehr vorgefunden. Es liegt nahe, das Grabräuber diese Grabkammer bereits in der Antike ausgeraubt haben.
1975 wurde die Grabstätte, über der eine Erdaufschüttung lag, bei Zusammenlegungsarbeiten beschädigt und 1976 legte man sie frei. Im Bereich der Wände befinden sich die Steinmetzzeichen »VI« und »AM«.
Im Jahr 2003 erfolgte der jetzt vorhandene Schutzbau gegen Witterungseinflüsse und die heutige Präsentation der Grabstätte.
Die römische Fernstraße von Köln nach Trier verlief an Dahlem vorbei. Sie folgte auf diesem Stück der Wasserscheide durch den Dahlemer Wald, weshalb sie hier auch nicht die typisch gerade Straßenführung hatte, sondern gewunden angelegt worden war.
Im Jahr 2000 wurde die ursprünglich 5,5 m breite Römerstraße archäologisch untersucht und der Aufbau des Straßenkörpers entschlüsselt: Auf einer planierten Fläche lag zu unterst eine Schicht aus verwittertem grauen Sandstein, um den Lehmboden zu befestigen und darauf kam eine dünne Lage kleinformatiger Bruchsteine, die vermutlich festgewalzt worden war. Darauf war eine 6 Zentimeter wassergebundene Decke als Verschleißschicht aufgelegt. Ein kleiner Graben am Straßendamm diente der Ableitung von Regenwasser.
Bei den Untersuchungen fand man noch diverse Ausbesserungsschichten, was davon zeugt, dass die Straße viel benutzt wurde. Dies führte nach und nach zu einer Erhöhung, aber auch zu einer Verschmälerung.
Hier im Dahlemer Wald ist ein Querschnitt der Straße zu sehen. Ein Schaukasten zeigt die Schichten mit denen die Straße angelegt worden war. Die Informationstafel gibt Erläuterungen dazu.
Der im Waldgebiet bei Dahlem erhaltene Straßendamm ist Teil des Rundweges »Moorpfad Dahlem«. Angeschlossen ist dieser Römerstraßenabschnitt auch an den Jakobsweg sowie den Eifeler Quellenpfad.
Römerstraßen-Aufschluss in Google Maps
Als im März 1980 mit dem geplanten Ausbau der Bundesstraße 267 begonnen wurde und der Schutt des Hanges beseitigt werden sollte, da griffen Bagger in römisches Mauerwerk und förderten Stücke mit farbiger Bemalung zu Tage. So wurden die Bauarbeiten eingestellt und das Gelände abgesichert. Das aufragende Mauerwerk von 1,5 Metern Höhe mit einem gut erhaltenen bemalten Verputz rechtfertigte die Errrichtungg eines Schutzbaues. Der Straßenbau wurde umgelegt.
In 11 Grabungskampagnen wurden zwischen 1980 und 1990 die Reste der Römischen Villa ausgegraben. Seit 1993 kann man die gut erhaltenen freigelegten Teile besichtigen und sind für jeden geschichtlich Interessierten eine wahre Fundgrube.
Die Römervilla am Silberberg gehörte einst einer wohlhabenden Familie, das zeigen die hochwertigen Wandmalereien.
Das Haupthaus liegt dicht an einem steilen Hang, welcher vor Witterungseinflüssen schützte. Die Frontseite zeigte nach Süden und wurde so von der Sonne angestrahlt. Von der Säulenarkade konnten die Bewohner einen freien Blick über die Niederungen der Ahr genießen. Der Gießemer Bach lieferte ihnen frisches Wasser.
Die Anlage besteht aus Haus I mit einem gut erhaltenen Keller, einem Heizraum, und einem Bad.
Haus II mit einer säulenbestandenen Portikus, mehreren Innenräumen mit Resten von Wandmalerien und Mamortäfelungen und einem Bad. Von Haus II gehen zwei Kanäle ab, wobei einer gut erforscht ist.
An späteren Umbauten fanden die Archäologen ein Hospiz (Rasthaus) mit Treppenhaus, Küche und Toilette.
Im vierten Jahrhundert wurden zwischen den damaligen Bauresten Schmelzöfen für die Metallschmelze errichtet, man fand aus dieser Zeit Bleischlacke, einen gussfrischen Bleibarren und eine dicke Bleiplatte. Gegen Ende des 4. Jahrhunderts wurden diese aufgegeben und nach und nach abrutschenden Hangschutt verdeckt.
Über dem Schutt des Bades und westlich davon entdeckte man einen Friedhof aus dem 7./8. Jahrhundert. Zu dieser Zeit dürften die Reste der Römervilla schon an der Oberfläche nicht mehr sichtbar und gänzlich zugeschüttet gewesen sein.
Dieser reiche Grabungsfundplatz brachte noch viele zeitgeschichtlich interessante Dinge hervor, u.a. ein Graffito, Keramikbruchstücke, Schmuck, Filbeln, Theatermasken und einen Ziegelstempel.
Ausführliche Informationen in wikipedia

Bild: Römerthermen Zülpich - Museum der Badekultur/wikipedia
Die »Römerthermen Zülpich – Museum der Badekultur« zeigen eine der besterhaltensten römischen Thermenanlagen.
Sie verdanken ihren ausgesprochen guten Zustand vor allem ihrer unmittelbaren Nachbarschaft zur Kirche St. Peter. Jahrhundertelang blieben die Ruinen unter dem Friedhofsgelände verborgen und vor schädlichen Eingriffen geschützt. Erst 1929 wurden die Reste der antiken Anlage beim Bau einer städtischen Kanalisation entdeckt.
auptattraktion des Museums sind die Überreste einer römischen Thermenanlage aus der Mitte des 2. Jahrhunderts n. Chr. Während ihrer fast zweihundertjährigen Nutzung wurde die Badeanstalt mehrmals aus- und umgebaut bis sie im 4. Jahrhundert aufgegeben wurde.
Heute führt ein archäologischer Rundweg die Besucher rund um die Thermen. An insgesamt 18 Stationen werden alle wichtigen Teile der Thermen erklärt. Darunter die unterschiedlich temperierten Räume des Frigidariums, Tepidariums und Caldariums, das Heizsystem mit seinen Präfurnien und Hypokausten wie auch die Wasserver- und -entsorgung.
Des Weiteren zeigt die Ausstellung, dass römische Thermen neben ihrer Funktion zur körperlichen Reinigung auch für das gesellschaftliche Leben von Bedeutung waren und gleichzeitig Orte antiker Wellness. Oftmals übten Ärzte in separaten Räumen ihr Handwerk aus. Wie ausgeprägt die Badelust der Römer auch auf dem Lande war, zeigt eine Unterabteilung. Sie beherbergt unter anderem das kostbare Inventar eines römischen Grabes aus Enzen.
Regelmäßig finden im Museum Vorträge und Lesungen statt. Einmal im Monat wird eine öffentliche Führung zu ausgewählten Themen angeboten.
Textausschnitte: Wikipedia
Mühlenberg 5
53909 Zülpich
Römerthermen in Google Maps
In der Eifel sind an vielen Stellen dieser Kalkvorkommen alte römische Brennöfen bekannt. Mehrere sind allein in der Sötenicher Mulde bei Inversheim freigelegt worden. Es handelt sich hier um ein großes römisches Kalkwerk.
Der Arbeitsablauf war derzeit schon gut organisiert, wobei vom Schläger (Brennmaterialbeschaffung) über den Brecher (Rohsteingewinnung) bis zum Brenner am Ofen eine reibungslose Arbeitskette aufgebaut wurde. Die römischen Öfen arbeiteten für heutige Verhältnisse wegen des hohen Brennmaterialverbrauches unwirtschaftlich. Die starke Abholzung ganzer Gebiete in der Eifel war nicht unwesentlich auf diesen Brennstoffbedarf zurückzuführen. Der gebrannte Kalk wurde ungelöscht als Stückkalk in Fässern auf Karren und per Schiff transportiert. Die Erft z.B. wurde jenerzeit durch Stau für kleine Boote schiffbar gemacht. Aber nicht erst seit der Römerzeit verstand sich der Mensch auf das Kalkbrennen. In Mesopotamien wurde bereits um 2000 v. Chr. Kalk gebrannt, wie ein ausgegrabener Kalkofen beweist.
Die römische Kalkbrennerei in Iversheim ist der museale Ausbau einer ehemaligen antiken Kalkfabrik. Sie bestand aus sechs nebeneinander liegenden Kalköfen, die von römischen Legionären der Legio XXX Ulpia Victrix und Legio I Minervia vermutlich in der Zeit von 150 n. Chr. bis 300 n. Chr. betrieben wurden.
Die Anlage wurde 1966 beim Bau einer Wasserleitung zufällig entdeckt und bis 1968 vom Rheinischen Amt für Bodendenkmalpflege ausgegraben. Heute befindet sich über einem Teil der Anlage ein Schutzbau, in dem drei der Öfen besichtigt werden können. Die Ausstellung im Schutzbau zeigt den Grabungsbefund, die Öfen wurden nicht restauriert. Der für den Brennversuch restaurierte Ofen außerhalb des Schutzbaus ist frei zugänglich. Die beiden weiteren Öfen wurden nach der Bestandsaufnahme wieder zugeschüttet.
Texte aus: »Geologische Streifzüge« von Wolfgang Spielmann, erschienen im Rhein-Mosel-Verlag und wikipedia
Römische Kalkbrennerei Ivresheim in Google Maps
















 Achterhöhe, 380 m, Lutzerath
Achterhöhe, 380 m, Lutzerath

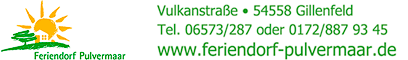





 »Begreifen durch erleben« mit viel Spaß, das ist das Konzept unserer außerschulischen Umweltpädagogik und unser Beitrag zur Nachhaltigkeit. Machen Sie Ihren nächsten Familienausflug oder Ihre Klassenfahrt in unsere schöne Eifelgemeinde mit ihrer erdgeschichtlichen, historischen und ökologischen Vielfalt.
»Begreifen durch erleben« mit viel Spaß, das ist das Konzept unserer außerschulischen Umweltpädagogik und unser Beitrag zur Nachhaltigkeit. Machen Sie Ihren nächsten Familienausflug oder Ihre Klassenfahrt in unsere schöne Eifelgemeinde mit ihrer erdgeschichtlichen, historischen und ökologischen Vielfalt.
 Hardtkopf, 596 m, Südeifel
Hardtkopf, 596 m, Südeifel