Das Kloster Niederehe ist ein ehemaliges Prämonstratenserinnenkloster in der Eifel.
Lage
Das heute noch gut erhaltene Kloster steht zentral in Niederehe, einem Ortsteil der Gemeinde Üxheim in Rheinland-Pfalz. Es befindet sich auf einer Höhe von etwas über 400 Meter über NHN südlich des Niedereher Bachs, der gut 1,6 Kilometer weiter östlich in den Ahbach mündet, einem rechten Zufluss der Ahr.
Geschichte
Im Jahre 1175 wurde von den Herren von Kerpen ein Kloster für adelige Jungfrauen nach der Augustinusregel im Tal des Niedereher Bachs gegründet, nachdem sie bereits 1162 von Rainald von Dassel, dem damaligen Erzbischof von Köln hierfür die grundsätzliche Erlaubnis erhalten hatten. Sie wurde von seinem Nachfolger im Amt, Philipp I. von Heinsberg, noch einmal urkundlich bestätigt. Das Stift war zunächst mit eher bescheidenen weltlichen Gütern (Grundbesitz) ausgestattet. Es wurde aufgrund eines Erlasses von Erzbischof Adolf I. nicht von einer Äbtissin, sondern von einer Magistra geführt mit der Begründung: „Damit sie nicht stolz werden“. Das Kloster wurde 1225 oder 1226 vom Kölner Erzbischof Heinrich I. der Abtei Steinfeld zugeordnet und war fortan den Regeln des Prämonstratenserordens unterstellt. Innozenz IV. stellte das Kloster unter päpstlichen Schutz. Im Laufe der Jahre wurden Besitztum und Vermögen des Klosters gemehrt durch (überwiegend) Schenkungen und Vermächtnisse seitens adeliger Stifter bzw. Bewohnerinnen und nicht zuletzt, da Bischof Aegidius von Jerusalem dem Kloster Einnahmen aus dem Ablasshandel bewilligte und aufgrund der Verehrung des heiligen Antonius ein reger Zustrom von Pilgern und Wallfahrern einsetzte. Im Zusammenhang mit dem wachsenden Wohlstand des Klosters wird in zeitgenössischen Quellen ein „Verfall der klösterlichen Zucht und der Sitten“ beschrieben, wobei Letzteres nicht näher ausgeführt wird. In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts das genaue Jahr wird in den verschiedenen Quellen mit 1461, 1474 sowie 1475 genannt, verwüstete ein Feuer das Klostergebäude praktisch vollständig sowie Teile der Kirche. Nach etlichen Jahren des Wiederaufbaus wurde Kloster Niederehe 1505 auf Betreiben des damaligen Landesherren Graf Diedrich IV. von Manderscheid-Schleiden mit päpstlicher Zustimmung in ein Männerkloster umgewandelt, das jedoch weiterhin der Prämonstratenserabtei Steinfeld unterstellt war, somit nunmehr von Prämonstratenserchorherren bewohnt wurde und einem Prior unterstand. 1567 konvertierten die Herren von Manderscheid-Schleiden zum Protestantismus. Während das Kirchenschiff nunmehr für evangelische Gottesdienste genutzt wurde, blieb der Chorraum der katholischen Gemeinde von Niederehe und dem Kloster, das nicht aufgelöst wurde, vorbehalten. Nach dem Tod des Grafen Diedrich IV. von Manderscheid-Schleiden 1593 wurde die Grafschaft wieder katholisch und 1595 übertrug Philipp von der Mark die Leitung des Klosters wieder der Abtei Steinfeld. 1752 und 1782 wurden umfangreiche Um- und Neubauten realisiert, wie zuletzt eine Neuerrichtung des Westflügels.
Das Ende des Klosters als geistliche Einrichtung kam zu Beginn des 19. Jahrhunderts nach der Besetzung der linksrheinischen Gebiete durch französische Revolutionstruppen während der Koalitionskriege und der Anerkennung der Annexion durch den Frieden von Lunéville 1801. 1803 wurde das Kloster im Zuge der Säkularisation unter Napoleon Bonaparte aufgelöst. Der Klosterbesitz fiel an den französischen Staat und wurde im Folgejahr versteigert, wobei die Kirche und Teile der Klostergebäude an die Pfarrei gingen.
Beschreibung
Die Kirche ist ein spätromanischer Saalbau, dessen Hauptschiff um 1200 aus Bruchsteinen errichtet wurde. Es hat eine Länge von 33,5 Metern bei einer Breite von etwa 6,5 Metern und besitzt vier Joche mit Kreuzgewölben. Der Chor ist nach Osten hin ausgerichtet und hat einen polygonalen Grundriss. Südlich (rechts) des Hauptschiffs befindet sich das deutlich niedrigere Seitenschiff. Es ist der älteste Teil der Kirche; seine Erbauung wird auf die Zeit zwischen 1162 und 1175 datiert. Hier befindet sich das Hochgrab des Grafen Philipp von der Mark und seiner Gemahlin Katharina von Manderscheid-Schleiden von etwa 1625 aus belgischem Marmor mit Reliefabbildungen der Verstorbenen. Weitere kunsthistorisch bedeutende Elemente sind u.a. das Chorgestühl von 1530, ein Triumphkreuz sowie mehrere Bildwerke und Statuen. Südlich an die Kirche ist der annähernd quadratische Turm angebaut. Er besitzt vier Etagen und darüber ein steil aufragendes, polygonales Zeltdach.
An der Nordseite der Kirche schließt sich der Klosterhof an, der im Norden und Westen von den rechtwinklig aneinandergebauten ehemaligen Klostergebäuden eingefasst wird und sich nach Osten zum Ort hin öffnet. Der Nordflügel wurde um 1650 errichtet. Der Westflügel wurde in den Jahren 1776–1782 auf älteren Grundmauern fast völlig neu erbaut und schließt unmittelbar an die Kirche an. Beide Klosterflügel besitzen über dem Kellergewölbe zwei Vollgeschosse und ausgebaute Mansarddächer mit Dachgauben. Sie sind ebenso wie die Kirche aus Bruchsteinen erbaut und verputzt. Der gesamte Komplex ist heute weiß getücht, wobei die Fenster- und Türeinfassungen sowie sonstige Zierelemente wie Fensterrosetten oder Eckpilaster farblich abgesetzt sind und überwiegend einen rotbraunen Farbton aufweisen.
Orgel
Der Orgelbaumeister Balthasar König hat die Orgel 1714/15 im Stil des Barock erbaut. Sie gilt als älteste bespielbare Barockorgel in Rheinland-Pfalz. 1997/98 erfolgte eine umfangreiche Restaurierung durch die Firma Orgelbau Fasen.
Gegenwart
Pfarrkirche St. Leodegar
Die ehemalige Klosterkirche dient heute als Pfarrkirche und ist dem heiligen Märtyrer Leodegar von Autun geweiht. Seit 1991 ist Niederehe Sitz einer Pfarreiengemeinschaft, zu der auch die Pfarreien in Üxheim, Nohn, Oberehe und Walsdorf gehören. In der heutigen Pfarrkirche finden regelmäßig Gottesdienste sowie etwa viermal jährlich Orgelkonzerte statt. Die Kirche ist grundsätzlich (außer bei besonderen Veranstaltungen) tagsüber geöffnet und frei zugänglich. Führungen finden nur an bestimmten Terminen oder nach Absprache statt.
In den ehemaligen Klostergebäuden befinden sich heute Einrichtungen der Pfarrgemeinde und Privatwohnungen.
Tourismus
Mehrere markierte Wanderwege berühren das Kloster oder führen in unmittelbarer Nähe vorbei, unter anderem der Geo-Pfad Hillesheim und der Eifelkrimi-Wanderweg. Hier ist der Schauplatz der Episode „Tote Forellen und röhrende Motoren“ nach der Vorlage von Jacques Berndorf.
Nur wenige Meter vom Kloster entfernt verläuft im Tal des Niedereher Bachs der Kalkeifel-Radweg als „Themenroute“ und Teilabschnitt eines überregionalen Fernradwegenetzes unter teilweiser Nutzung von Abschnitten der ehemaligen Bahntrasse der zurückgebauten (oberen) Ahrtalbahn im Streckenabschnitt zwischen Dümpelfeld und Lissendorf. Es bestehen Anbindungen an den Kylltal-Radweg im Westen und die Mineralquellen-Route im Osten mit Weiterführung zum nördlich verlaufenden Ahr-Radweg.
Denkmalschutz
Als Denkmalzone „Im Klosterhof 1–5“ ausgewiesen sind der Westflügel (Im Klosterhof 1 und 2) von 1776, der heute in Wohneinheiten aufgeteilte Nordflügel (Im Klosterhof 3, 4 und 5), die Umfassungsmauer aus Bruchsteinen sowie die heutige Pfarrkirche nebst Inventar.
(Text: Wikipedia)
Kloster Niederehe in Google Maps

Das Kloster Rosenthal (Vallis Rosarum) ist ein ehemaliges Zisterzienserinnenkloster im Pommerbachtal unterhalb der Gemeinde Binningen in der Eifel, im heutigen Landkreis Cochem-Zell. Außer einem Muttergottes-Kapellchen an der Stelle des früheren Hochaltares sind von den Gebäuden nur wenige Mauerreste erhalten (Foto).
Geschichte
Das möglicherweise der Mutter Gottes geweihte Kloster wurde vermutlich in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts für adelige Nonnen gegründet. Über die Identität der Gründer herrscht Unklarheit. Es könnten Dietrich von Wesel, ein Graf von Virneburg oder ein Herr von Schönberg gewesen sein. Unter den Äbtissinnen waren mehrere Gräfinnen von Virneburg. 1241 stiftete Demude von Bell eine Messe im Kloster. Die Pfarrei Hambuch wurde ihm 1251 inkorporiert; im 13. und 14. Jahrhundert erhielt es weitere Schenkungen, arrondierte seinen Besitz aber auch durch Kauf. 1304 unterstellte sich das Kloster der Aufsicht und Seelsorge des Klosters Himmerod. 1322 stiftete die Familie Vrye von Treis einen Georgsaltar. Ein Muttergottesaltar wird 1422 erwähnt. 1455 bat der Konvent Kaiser Friedrich III. um Schutz gegen Übergriffe der benachbarten Burgherren. Seit 1587 stammten die Rosenthaler Äbtissinnen nicht mehr aus dem Adel. Die Vereinigung mit dem Oberweseler Allerheiligenkloster, die die trierische Verwaltung befürwortete, kam nicht zustande.
Klostergebäude
Im 16. Jahrhundert waren Teile der Klostergebäude baufällig und wurden erneuert. Auch Ende des 17. Jahrhunderts mussten Baumaßnahmen ergriffen werden. 1784 wurden die Kirche und der westlich anschließende Klosterflügel abgerissen. Ein Neubau wurde 1785 wegen Mangel an Mitteln, weil nur noch neun oder zehn Nonnen im Kloster waren, eingestellt. Jedoch ermöglichte eine Schenkung die Neuerrichtung, die 1787 durch den Abt von Himmerod eingeweiht werden konnte. 1802 wurde das Kloster im Gefolge der Französischen Revolution und der Säkularisation auf Grund des Reichsdeputationshauptschlusses aufgehoben und 1804 zum Abriss versteigert.
Siegel
Das große Siegel des Klosters zeigt die thronende Muttergottes in Frontansicht mit dem Kind auf dem linken Knie und einer Lilie in der Rechten, das kleine Siegel die Muttergottes von der Seite mit stehendem Kind in Frontansicht. Den Hintergrund bildet ein mit Lilien belegter Schrägbalken.
(Text: Wikipedia)
Kloster Rosenthal in Google Maps

Kloster Reichenstein ist ein ehemaliges Prämonstratenserkloster aus dem 12. Jahrhundert in Kalterherberg in der Eifel. Nach der Auflösung in Folge der Säkularisation kam das Gut Reichenstein in private Hände. 2008 erwarb die der Priesterbruderschaft St. Pius X. verbundene französische Abtei Notre-Dame de Bellaigue die Gebäude, um dort eine Niederlassung zu gründen.
Das Kloster liegt tief im Tal der Rur, ca. 30 km südlich von Aachen, ca. 5 km westlich der Stadtmitte von Monschau, unweit der belgischen Grenze in der Städteregion Aachen.
Architektur
Aus der Klosterzeit sind nur noch das ehemalige Priorat, die Klosterkapelle und der hinter der Kapelle liegende Wirtschaftsflügel erhalten. Die übrigen Gebäude um den Wirtschaftshof stammen aus dem 19. Jahrhundert. Die Kapelle ist ein Bruchsteinbau mit 3/8-Chorschluss. Sie erhielt 1980 ein neues Schieferdach. Das Priorat, ein zweigeschossiger Bruchsteinbau und die anderen zum Hof hin gelegenen Nebenhäuser sind bereits in den 1970er Jahren vorwiegend mit Schieferdächern versehen worden.
Geschichte
1131/36 schenkten die Herzöge von Limburg ihre Burg Richwinstinne (Reichenstein) dem Prämonstratenserorden. Das dort gegründete Kloster war bis 1250 Doppelkloster, also ein Kloster für Chorfrauen und -herren. Später verließen die Chorherren das Kloster und gingen zu ihren Mitbrüdern nach Kloster Steinfeld. Bis 1487 blieb Reichenstein Prämonstratenserinnen-Kloster.
1487 verließen die letzten Chorfrauen Reichenstein, Kanoniker aus Steinfeld besetzten im Gegenzug wieder das Kloster.
1543 wurde Reichenstein im Dritten Geldrischen Erbfolgekrieg durch Truppen Karls V. (Karl von Egmond) zerstört, in der Folgezeit aber wieder aufgebaut.
1639 bis 1686 war Stephan Horrichem Prior des Klosters Reichenstein, der bis heute noch als "Apostel des Venns" verehrt wird. Der Wiederaufbau des Prioratsgebäudes in seiner heutigen Form erfolgte 1687. Die Segnung und Weihe der wiedererrichteten Klosterkirche erfolgte dann im Jahre 1693. 1802 wurde das Kloster im Zuge der Säkularisation durch Napoléon Bonaparte aufgelöst. Die Ländereien und die ehemaligen Klostergebäude wurden versteigert und zu einem land- und forstwirtschaftlichen Betrieb umfunktioniert.
Die Anfänge der meteorologischen Messungen im oberen Rurtal gehen auf "eine Initiative des Guts Reichenstein" zurück. Schon 1891 wurde versuchsweise der Einsatz des Hellmannschen Regenmessers (siehe Gustav Hellmann) getestet. Nach Angaben des Wetteramtes Essen war der offizielle Beginn der Niederschlagsmessungen der 1. Juli 1892.
Die Klosterkirche wurde zunächst als Schafstall, später für eine Käsefabrikation und schließlich bis 1971 als Heustall genutzt. 1971 war der Gebäudekomplex Drehort für eine Folge der ARD–Kriminalfilmreihe Tatort
Im Jahre 1973 wurde "Gut Reichenstein" von Privatpersonen erworben und weitgehend restauriert. Das ehemalige Prioratsgebäude wurde Wohngebäude der Eigentümer.
Im September 2008 übernahm das der Priesterbruderschaft St. Pius X. verbundene französische Kloster Notre-Dame de Bellaigue das Gut Reichenstein, um dort ein Kloster nach der Benediktsregel einzurichten. Am 16. Mai 2009 wurde die Klosterkirche vom Prior der Gründerabtei Bellaigue neu eingesegnet. Das Amt für Denkmalpflege im Landschaftsverband Rheinland erklärte: „Die angedachte Nutzung stellt aus denkmalpflegerischer Sicht einen Idealfall dar“.
(Text: Wikipedia)
Kloster Reichenstein in Google Maps
Das Kloster Springiersbach ist ein ehemaliges Augustiner-Chorherrenstift und heute ein Kloster der Karmeliten bei Bengel in der Eifel, 16 km von Wittlich entfernt.
Geschichte
Das Kloster wurde 1102 von Bruno von Lauffen, 1102–1124 Erzbischof von Trier, in Anwesenheit des Pfalzgrafen Siegfried I. von Ballenstedt geweiht. Diese Weihe gilt als Gründung des Klosters Springiersbach, benannt nach dem gleichnamigen Bach und Tal. Erster Abt war Richard I. († 1158), Sohn der Benigna de Duna (Benigna von Daun), einer adeligen Ministerialen aus der Eifel, auf deren Hof Thermunt, den sie mit allen Ländereien dem Erzbischof vererbte, die erste Zelle des Klosters entstand. Die Augustinusregel mit Schweigen, Fasten, Arbeiten und Beten wurde als Ordensregel ausgewählt und war damit die Grundlage der Gemeinschaft.
Bereits 1107 wurde das Kloster in den Wirren der Kreuzzüge dem Erzbischof entzogen, die Brüder durften ihren Abt frei wählen. Zutritt zur Gemeinschaft erhielten nur Adelige, die ihren gesamten Besitzstand dem Kloster zu vermachen hatten – inklusive Ländereien, Wäldern, Dörfern, was für das Kloster einen ungeahnten wirtschaftlichen Aufschwung bedeutete. So besaß das Kloster um 1140 bereits Weinberge in Bridal (Briedel) an der Mosel. 1144 wurden die Rechte und Besitztümer des Klosters durch den römisch-deutschen König Konrad III. und 1193 erneut durch Kaiser Heinrich VI. bestätigt.
Am 30. Januar 1299 erwarb das Kloster ein zweites Weingut in „Pleyt“ in Edegry (Ediger). Im Jahre 1752 wurde der Springiersbacher Hof in Ediger unter Abt Johann Heinrich von Wasserberg (1728–1758) neu gebaut. 1794 übernahm Hofmann Nikolaus Becker die Verwaltung des Springiersbacher Hofes in Ediger.
Der Weinberg des Klosters Springriersbach bestand aus drei Klassen mit einer unterschiedlichen Anzahl an Stöcken: die 1. Klasse besaß 1693 Stöcke, die 2. Klasse 1481 Stöcke und die 3. Klasse war mit 7262 Stöcken die größte. Becker gab die Hälfte des Weines an das Kloster ab. In die Amtszeit des ersten Abtes Richard I. fiel 1129 auch die Neugründung des adeligen Augustinerinnenstiftes „Unsere Liebe Frau vor den Mauern“ zu Andernach durch Wiederherstellung des verfallenen Klosters St. Maria auf Betreiben des Meginher von Vianden, Erzbischof von Trier. 1135 wurde die dreischiffige romanische Basilika des Klosters vom Trierer Erzbischof A(dal)bero von Montreuil (* 1080, Erzbischof 1131–1152) geweiht. Sie war die erste aus Stein gebaute Kirche des Klosters und ersetzte die alte Holzkirche.
In den nächsten dreihundert Jahren wuchs die Abtei an Größe und Ruhm, doch machte sich auch der sittliche Verfall bemerkbar, der sich trotz Interventionen Roms und der Äbte soweit manifestierte, dass nach weiteren Jahrhunderten 1791 schließlich der damalige Trierer Erzbischof und Kurfürst Clemens Wenzeslaus von Sachsen (1739–1812, Erzbischof 1768–1801) das Augustinerkloster in ein weltliches Adelsstift umwandelte. 31 Jahre später fiel Springiersbach unter die Säkularisation von Kaiser Napoléon Bonaparte und wurde geschlossen, das jahrhundertealte deutsche Klostersystem durch die französische Revolution abgeschafft. Die erst 1769 errichtete Rokokoklosterkirche, erbaut nach dem Vorbild von St. Johann und der Ludwigskirche zu Saarbrücken, wurde 1802 vom Trierer Bischof Charles Mannay zur Bengeler Pfarrkirche geweiht und entging somit dem unausweichlichen Abriss. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde die Kirche geschlossen, da Bengel inzwischen eine eigene Pfarrkirche erhalten hatte.
Im Jahre 1922 gründete die Oberdeutsche Provinz der Karmeliten aus Bamberg einen kleinen Konvent im Kloster Springiersbach und nahm die 1940 abgebrannte und 1946 wieder errichtete Kirche sowie die Klostergebäude, die in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts im Rokokostil neu errichtet worden waren und die romanischen Bauten ersetzt hatten, wieder in Betrieb.
1962 wurden Teile des Klosters durch den Architekten Walter Neuhäusser saniert und neugestaltet.
(Texte: Wikipedia)
Kloster Springiersbach in Google Maps

Kloster Steinfeld in der Eifel ist eine ehemalige Prämonstratenserabtei mit einer bedeutenden Basilika aus dem frühen 12. Jahrhundert. Weithin sichtbar auf einer Anhöhe im Süden der nordrhein-westfälischen Gemeinde Kall gelegen, bildet das „Eifelkloster“ mit wenigen umliegenden Häusern den Ortsteil Steinfeld.
Die Klosteranlage befindet sich seit 1923 im Besitz des Salvatorianerordens, der in Steinfeld das Hermann-Josef-Kolleg Steinfeld, ein Gymnasium mit Internat, sowie die private Kunstakademie Kloster Steinfeld und das Franziskus-Jordan-Gästehaus unterhält.
Geschichte
Obwohl die Anfänge des Klosters bis circa 920 zurückreichen, erfolgte die erste klösterliche Niederlassung in Steinfeld 1070. 1130 wurde es von Prämonstratensern übernommen. Das Kloster wurde ein bedeutendes kirchliches Zentrum im deutschen Reich und hatte zahlreiche Tochterniederlassungen in Europa, zum Beispiel das Kloster Strahov in Prag. 1184 bekam das Kloster Steinfeld den Status einer Abtei. Die durchgehende Reihe von 44 Äbten wurde erst 1802 durch die Säkularisation beendet. Danach diente die Anlage verschiedenen weltlichen Zwecken, die Basilika wurde als Pfarrkirche weiterbetrieben. Die Anlage wurde 1923 von den Salvatorianern als Kloster übernommen.
Basilika
Die dem Kloster angeschlossene Basilika wurde zwischen 1142 und 1150 als eine der frühesten deutschen Gewölbekirchen von den Prämonstratensern erbaut. Sie ist dem heiligen Potentinus und seinen beiden Söhnen Felicius und Simplicius geweiht. Heute umfasst das Gebäude Teile mehrerer Kunstrichtungen, vom originalen romanischen Stil über Gotik, Renaissance und Barock bis zu modernen Stahlapplikationen. Die Basilika umfasst insgesamt acht Joche und sechs Kapellen, darunter die Stephanuskapelle und die Ursulakapelle. Die Basilika enthält auch die bekannte König-Orgel sowie die sterblichen Überreste des als Heiligen verehrten Hermann Joseph von Steinfeld. Den Rang einer päpstlichen Basilica minor erhielt die Kirche 1960.
Hermann-Josef-Grab
Das Grab Hermann Josephs von Steinfeld, in der Mitte der Kirche platziert und von einer 1732 hergestellten Platte mit einer liegenden Figur aus Alabaster bedeckt, macht die Kirche zu einem Wallfahrtsort. Das eigentliche Grabmal aus Urfter Marmor stammt aus dem Jahr 1701. Traditionellerweise liegen stets ein paar frische Äpfel auf dem Grab neben der Alabaster-Figur. Nach einer Legende soll Hermann Joseph einmal dem Jesuskind der Muttergottes in der Kirche St. Maria im Kapitol zu Köln einen Apfel angeboten haben, den es angenommen habe.
König-Orgel
Bereits im 16. Jahrhundert verfügte die Steinfelder Basilika entweder über eine Schwalbennestorgel an der nördlichen Langschiffwand oder eine Lettner-Orgel. 1509 wurde der Lettner vom dritten Joch ins Eingangsjoch der Kirche versetzt, wo um 1600 – vermutlich durch Floris Hoque aus Brabant – die erste große Orgel entstand. Für diese Orgel wurde 1678 im Barockdekor ein neues achtfüßiges Hauptwerksgehäuse errichtet. Nach 1720 wurde sie durch ein Rückpositivgehäuse und zwei Pedaltürme in der Emporenbrüstung ergänzt. Vollendet wurde die Orgel 1727 durch Balthasar König aus Bad Münstereifel. König verwendete hierzu die alten Pfeifenbestände (17 Register). So entstand ein Orgelwerk mit 29 Registern.
Eine Modernisierung (Erweiterung auf 46 Register, Elektrifizierung der Spiel- und Registertraktur) erfuhr die Orgel im Jahre 1934. 1977 wegen Funktionsstörungen stillgelegt, wurde sie – nach umfangreichen Forschungsarbeiten – 1981 im ursprünglich barocken Stil von der Orgelbaufirma Weimbs aus Hellenthal aufwändig restauriert, so dass sie sich nun, was Spieltechnik und Klang betrifft, weitgehend wieder im Zustand von 1727 befindet. Sie umfasst 1956 Pfeifen, 35 klingende Register und eine mechanische Spiel- und Registertraktur. Das Pfeifenwerk ist größtenteils original erhalten. An den ältesten Pfeifen sind noch Gießtuchspuren zu erkennen. Es handelt sich um eine der bedeutendsten Orgeln des rheinischen Barock.
(Texte: Wikipedia)
Kloster Steinfeld in Google Maps
















 Achterhöhe, 380 m, Lutzerath
Achterhöhe, 380 m, Lutzerath

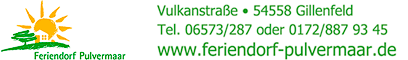





 »Begreifen durch erleben« mit viel Spaß, das ist das Konzept unserer außerschulischen Umweltpädagogik und unser Beitrag zur Nachhaltigkeit. Machen Sie Ihren nächsten Familienausflug oder Ihre Klassenfahrt in unsere schöne Eifelgemeinde mit ihrer erdgeschichtlichen, historischen und ökologischen Vielfalt.
»Begreifen durch erleben« mit viel Spaß, das ist das Konzept unserer außerschulischen Umweltpädagogik und unser Beitrag zur Nachhaltigkeit. Machen Sie Ihren nächsten Familienausflug oder Ihre Klassenfahrt in unsere schöne Eifelgemeinde mit ihrer erdgeschichtlichen, historischen und ökologischen Vielfalt.
 Hardtkopf, 596 m, Südeifel
Hardtkopf, 596 m, Südeifel